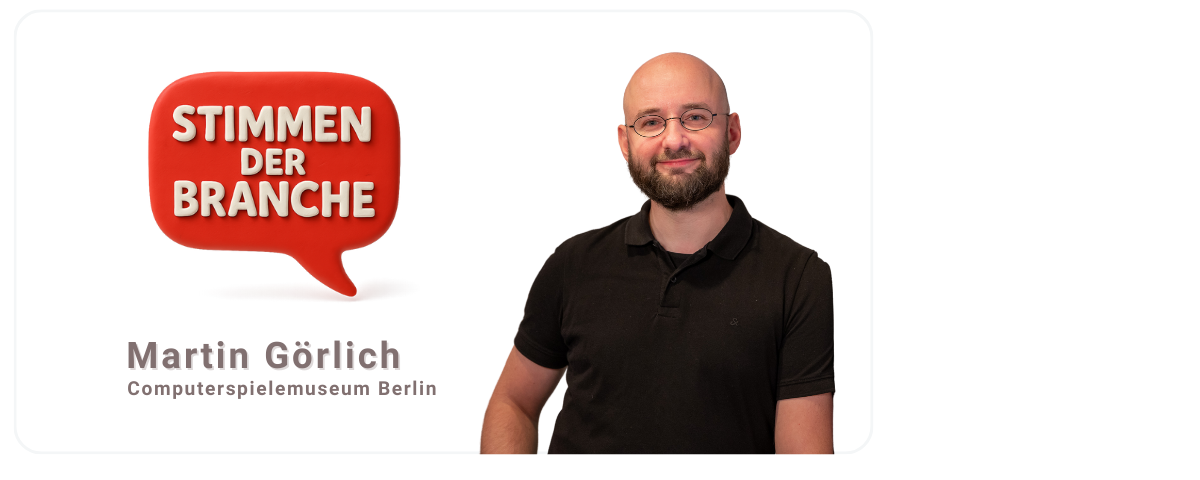Martin Görlich leitet seit zweieinhalb Jahren als Geschäftsführer die Geschicke des Computerspielemuseums, das bereits 1997 gegründet wurde und seit 2011 in seiner heutigen Form als gemeinnützige GmbH betrieben wird. Seit rund zwölf Jahren ist er in verschiedenen Funktionen für das Museum tätig und prägt damit maßgeblich dessen Entwicklung und Ausrichtung.
Die Studie Power of Play 2025 hat gerade bestätigt, dass Gaming einen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit hat. Glauben Sie, dass dieses Wissen und die positiven Effekte von Videospielen mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind?
Ich glaube, das ist noch nicht vollständig angekommen. Viele Menschen wissen, dass Spielen Spaß macht und man dabei gut abschalten kann. Aber dass es auch eine echte Form der Stressbewältigung ist oder die mentale Gesundheit unterstützt, ist vielen noch nicht so bewusst. Für die, die selbst spielen, ist das klar – sie genießen die Zeit und die Ablenkung. Für andere, die das nur beobachten, wirkt es oft wie normale Freizeitgestaltung.
Wiehat sich die Wahrnehmung von Computerspielen in der Gesellschaft seit der Eröffnung des Museums 1997 verändert?
Sehr stark, würde ich sagen. Früher wurden Spiele nicht als Kulturgut anerkannt. Ein wichtiger Schritt war 2007, als der Kulturrat offiziell erklärte: Computerspiele sind Kulturgut. Genau wie Bücher oder Filme gibt es Spiele, die bestimmte Interessen ansprechen oder Geschmäcker treffen – und natürlich auch Spiele, die weniger ansprechen.
Heute sehen wir eine deutliche Veränderung. Ein schönes Beispiel: Der polnische Ministerpräsident hat damals Barack Obama das Spiel „The Witcher 2“ als diplomatisches Geschenk überreicht. Solche Anerkennungen fehlen in Deutschland zwar noch, aber das zeigt, wie sehr sich die Wahrnehmung international verändert hat. Auch die Besucherzahlen unseres Museums sprechen dafür: Start 1997 mehrere Zehntausend, letztes Jahr 140.000 – ein enormer Unterschied. Das Interesse an der Geschichte von Spielen ist also definitiv gestiegen.
Stichwort „Lost Games“ oder Abandonware: Wie bewerten Sie das Verschwinden alter Spiele? Sollte mehr zum Erhalt getan werden?
Absolut. Das ist ja genau unsere Aufgabe. Wir versuchen, alte Spiele und Hardware – von Disketten über Cartridges bis hin zu DVDs – zu erhalten und möglichst zugänglich zu machen. Abandonware ist dabei ein anderes Thema. Wichtiger ist: die Spiele selbst, ihre Geschichten, wer daran gearbeitet hat, Grafiken, Konzepte, Synchronsprecher – all das geht schnell verloren. Besonders bei digitalen Daten muss man schnell handeln, bevor Firmen sich auflösen oder Materialien unzugänglich werden. Wir als private gemeinnützige Institution tun so viel wir können, aber es bräuchte auch mehr Unterstützung auf Landes- oder Bundesebene.
Trends wie Minikonsolen und Plattformen wie GOG zeigen, dass es ein wachsendes Bewusstsein für alte Spiele gibt. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist definitiv der Fall. Viele Projekte entstehen aus Leidenschaft, wie beim Vectrex-Revival, bei dem Menschen versuchen, alte Systeme wiederzubeleben. Diese Retro-Welle erfüllt den Wunsch, alte Spiele noch einmal zu erleben. Minikonsolen sprechen genau dieses Gefühl an: Ich will meine alten Spiele noch einmal spielen, aber in einem modernen, komfortablen Format. Gleichzeitig entstehen viele Projekte auch unabhängig in der Community, etwa über Kickstarter. Das zeigt: Das Interesse an der Geschichte und an alten Systemen ist sehr lebendig.
Videospielentwickler stehen oft unter immensem wirtschaftlichen Druck. Ist das fragwürdig, wenn man Spiele doch als Kulturgut betrachtet? Sollte es Förderungen aus dem Kulturhaushalt geben?
Förderung ist sehr wichtig. Besonders bei neuen Projekten brauchen Entwickler Zeit, um sich voll darauf konzentrieren zu können – etwa durch Stipendien oder spezielle Förderprogramme. Steuerliche Anreize wie Tax Credits helfen, größere Projekte planbar zu machen. Spiele sind zwar Kulturgut, aber eben auch Wirtschaft: Es geht um Verkaufszahlen, Marketing und Umsätze. Förderungen sollten daher vor allem solche Projekte unterstützen, die gesellschaftlich oder kulturell wertvoll sind, aber wirtschaftlich nicht unbedingt erfolgreich sein müssen – wie etwa Serious Games oder Lernspiele.
Nach welchen Kriterien werden Spiele in die Sammlung des Computerspielemuseums aufgenommen?
Es gibt mehrere Wege. Einer ist über Spenden: Da hängt es davon ab, was Sammler uns überlassen. Dann schauen wir auf Dubletten – also Spiele, die wir bereits besitzen – und auf thematische Lücken. Auch Sonderausstellungen spielen eine Rolle: Wir durchsuchen unsere Archive gezielt nach relevanten Objekten, die vielleicht nicht in der Datenbank erfasst sind. Natürlich muss das Ganze auch finanzierbar bleiben. Insgesamt haben wir bereits mehrere Zehntausend Spiele in der Sammlung.
Gibt es noch besondere Spiele oder Hardware, die Sie aktuell suchen?
Ja, ein Beispiel ist barrierefreies Gaming. Wir zeigen z. B. einen Mund-Controller für den NES aus den 80er Jahren – das war ein früher Versuch, Spiele für Menschen mit Einschränkungen zugänglich zu machen. Solche Exponate sind selten, aber sehr wertvoll. Natürlich interessieren uns auch klassische Hardware-Raritäten wie der Virtual Boy oder spezielle Cartridges.
Sind Retro-Games aus Ihrer Sicht „bessere“ Spiele, weil sie ohne Mikrotransaktionen, Online-Zwang oder ständige Updates auskommen?
Das ist Geschmackssache. Viele Retro-Games bieten Komfort und Nostalgie, aber auch moderne Plattformen wie GOG ermöglichen Offline-Spiel ohne Online-Zwang. Indie-Spiele bedienen oft Nischen und sind nicht auf Triple-A-Maßstäbe angewiesen. Persönlich spiele ich alte Spiele gern wieder – ähnlich wie bei alten Serien auf Netflix. Es geht um die Erfahrung, die Erinnerung und den entspannten Spielgenuss. Natürlich haben moderne Spiele Vorteile wie Autosave und verbesserte Steuerung, aber der nostalgische Reiz bleibt.